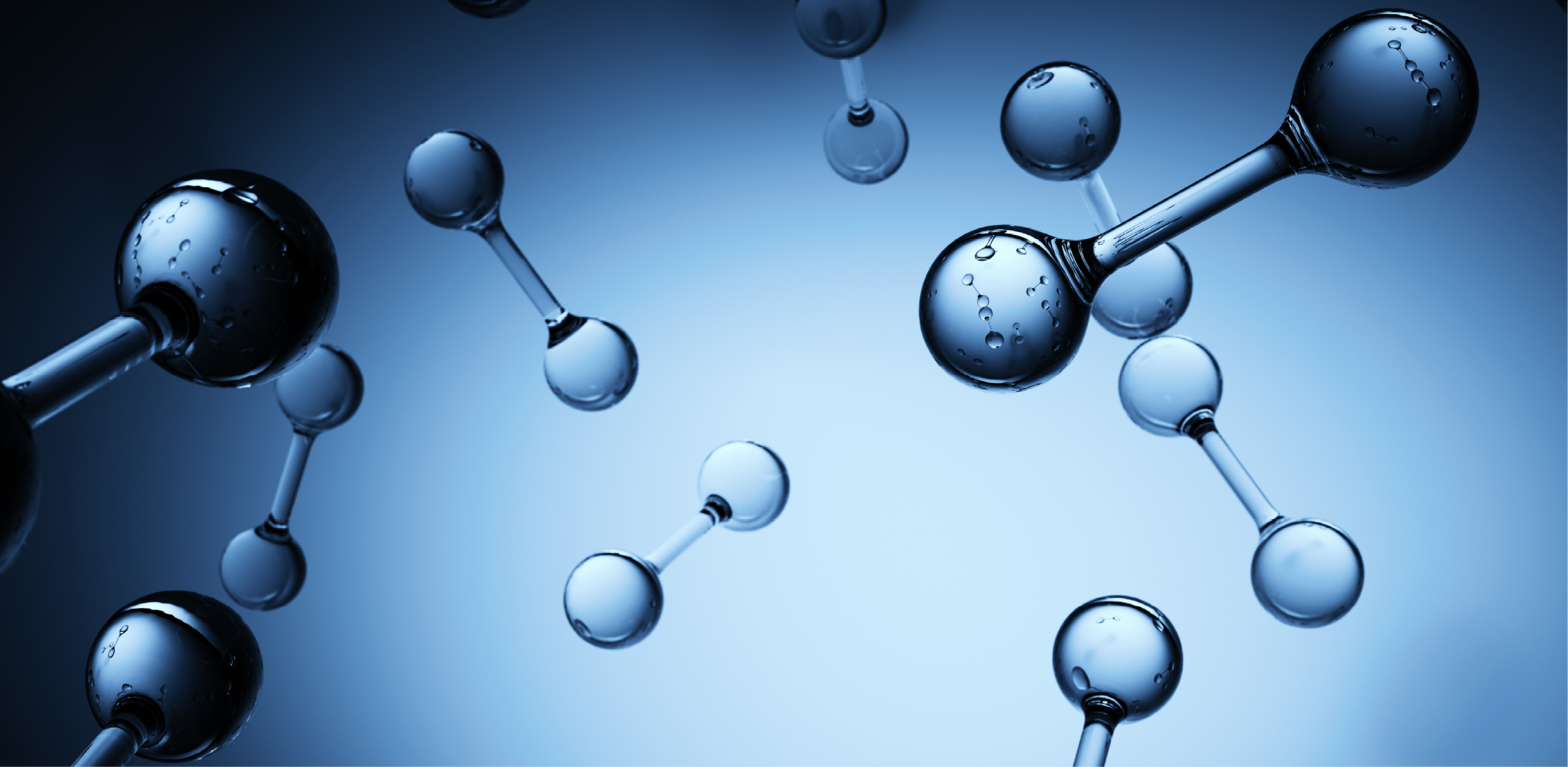Wasserstoff ist das erste Element im Periodensystem der Elemente. Es ist das leichteste Element und kommt zudem am häufigsten in unserem Universum vor. Die Energiedichte von Wasserstoff ist sehr hoch. Zum Vergleich: Die Energie von einem Kilogramm Wasserstoff entspricht etwa der von drei Kilogramm Benzin, Diesel oder Erdgas. Jedoch liegt Wasserstoff auf der Erde nur sehr selten in seiner elementaren Form vor, sondern ist überwiegend chemisch gebunden – beispielsweise in Form von Wasser, Biomasse oder anderen Kohlenwasserstoffen wie Erdöl oder Erdgas.
Was Wasserstoff so wertvoll macht, ist, dass er vielfältig einsetzbar ist und in den verschiedensten Bereichen Verwendung findet. So kann beispielsweise Strom aus erneuerbaren Energien in Wasserstoff gespeichert werden. Das hilft, die schwankende Verfügbarkeit von Wind oder Sonne auszugleichen. Zudem kann Wasserstoff in synthetische Kraftstoffe umgewandelt werden. So lassen sich auch schwer elektrifizierbare Bereiche erreichen. Und das ist noch nicht alles: Viele Möglichkeiten bietet Wasserstoff auch für die Dekarbonisierung der Industrie und in Sachen Mobilität und Verkehr – derzeit vor allem für den Schwerlastverkehr.
Wasserstoff ist ein zukunftsträchtiger Energieträger. Langfristig gedacht, kann er eine Schlüsselrolle in einem Energiesystem ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe einnehmen.